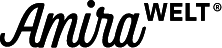Warum wir Gendermedizin brauchen
<p>Obwohl geschlechtsspezifische Unterschiede in der Arzneimitteltherapie schon lange bekannt sind, findet das Thema in der Ausbildung und im Berufsalltag zu wenig Beachtung. Doch ein Umdenken könnte Leben retten.</p>
Gendermedizin – geschlechtsspezifische Aspekte in der Therapie
Das Wort „gender“ muss derzeit viel mitmachen: Auf der einen Seite wird gefordert, dass unsere Sprache Frauen und Männer gleichermaßen ansprechen soll. Sternchen, Doppelpunkte und „-innen“ – es gibt verschiedene Möglichkeiten der Umsetzung. Auf der anderen Seite bemängeln Kritiker:innen die Lesbarkeit von Texten und unterstellen Feminismus an unnötiger Stelle. Von (fehlenden) Gendersternchen oder Doppelpunkten wird wahrscheinlich keiner sterben. Doch das fehlende Wissen an geschlechtsspezifischen Unterschieden in der Pharmakologie und -kinetik kann gefährlich werden – vor allem für Frauen.
Frauen und Männer sind anders krank
Als Teil der personalisierten Medizin legt die Gendermedizin den Fokus auf die therapierelevanten, geschlechtsbezogenen Unterschiede zwischen Frauen und Männern und berücksichtigt sowohl das biologische als auch das sozial konstruierte Geschlecht („gender“). Damit verbunden ergibt sich eine geschlechtsspezifische Erforschung und Behandlung von Krankheiten, von der nicht nur Frauen profitieren.
Seit längerem ist bekannt, dass es bei Frauen und Männern Unterschiede in der Häufigkeit, Wahrnehmung und Ausprägung bestimmter Erkrankungen gibt. Studien zeigen, dass Frauen beispielsweise fast dreimal häufiger an einer rheumatoiden Arthritis (RA) erkranken als Männer. Das weibliche Geschlecht ist ein Risikofaktor für Autoimmunerkrankungen wie der RA, aber auch für Stoffwechselstörungen wie Hypothyreose. Von einer Schilddrüsenunterfunktion sind daher eher Frauen betroffen.
Die Rolle des Geschlechts bei Arzneimittelwirkungen
Frauen und Männer unterscheiden sich nicht nur in den primären und sekundären Geschlechtsmerkmalen. So haben Frauen einen größeren Anteil an Fett, einen (zyklusabhängigen) Wasseranteil und weniger Muskelmasse als Männer. Zudem wiegen sie auch meist um die zehn Kilogramm weniger als altersgleiche Männer, weshalb es zu unterschiedlichen Verteilungsvolumina zwischen den Geschlechtern kommt.
Weiterhin metabolisieren Frauen in hohem Ausmaß eigene Hormone wie Östrogene. Auch die Enzymausstattung unterscheidet sich: Die Expressionen von CYP3A4-Proteinen und mRNA sind bei Frauen deutlich ausgeprägter. Da Östrogene Substrate von CYP3A4 sind, können entsprechende Arzneimittel-Wechselwirkungen mit CYP-Inhibitoren und -Induktoren auftreten. Zudem muss beachtet werden, dass Östrogene dem enterohepatischen Kreislauf unterliegen, während er für Androgene wahrscheinlich unbedeutend ist.
Die physiologischen Gegebenheiten führen dazu, dass sich pharmakokinetische Parameter zwischen Männern und Frauen unterscheiden. Beispielsweise ist bekannt, dass Frauen bei der Elimination des synthetischen Glucocorticoids Methylprednisolon eine höhere Clearance als Männer haben. Wissenschaftler:innen haben auch festgestellt, dass die maximale Plasmakonzentration nach der Einnahme von 100 mg Metoprolol-Tartrat zweimal täglich bei Frauen viel höher ist als bei Männern. Außerdem kam es bei Frauen zu einer stärkeren Senkung der Trainingsherzfrequenz und des systolischen Blutdrucks.
Mehr Nebenwirkungen bei Frauen
Es ist daher nicht verwunderlich, dass geschlechtsspezifische Unterschiede in der Pharmakokinetik zu einer höheren Rate an unerwünschten Arzneimittelwirkungen (UAW) bei Frauen beitragen. Studienergebnisse aus verschiedenen Teildisziplinen der Medizin belegen, dass sich nicht nur die Pharmakokinetik, sondern auch die -dynamik bei Frauen und Männern signifikant unterscheiden. So kommen beispielsweise arzneimittelinduzierte Torsade de pointes bei Frauen doppelt so häufig wie bei Männern vor. Zusätzlich kann die gefürchtete Nebenwirkung der QT-Zeitverlängerung zyklusabhängig auftreten.
Außerdem ist die Verträglichkeit von Betablockern, die über CYP2D6 metabolisiert werden, geschlechtsabhängig. Klinische Untersuchungen zeigen, dass es eine geschlechtsspezifische Häufigkeit an Krankenhausaufenthalten nach der Einnahme dieser Arzneimittel gibt – Frauen wurden vermehrt in die Klinik eingeliefert, weil sie das Medikament nicht vertragen haben. Es lässt sich allgemein sagen: Frauen sind insgesamt öfter von Nebenwirkungen betroffen als Männer. Expert:innen gehen davon aus, dass diese Rate bei Frauen um 30 Prozent höher liegt.
Medikamente werden eher an Männern getestet – mit Folgen für Frauen
Untersuchungen zeigen, dass Frauen in klinischen und präklinischen Studien unterrepräsentiert sind. Dies wird unter anderem wegen der Erfahrungen mit Thalidomid (Contergan®, Grünenthal) historisch begründet. Viele auf dem Markt befindlichen Arzneimittel wurden nicht oder nur zu einem geringen Teil an Frauen getestet. Derzeit wird die repräsentative Berücksichtigung von Frauen in Studien zwar aus wissenschaftlicher und auch behördlicher Sicht gefordert, doch einheitliche Regelungen, wie viel Prozent der Studienteilnehmenden weiblich sein müssen, gibt es nicht.
Neue Erkenntnisse finden zudem nicht immer schnell Zugang in die Fach- und Gebrauchsinformationen. Dieser Zustand kann zur Folge haben, dass manche Wirkstoffe bei Frauen beispielsweise unter- oder überdosiert werden bzw. gesundheitsschädliche sowie lebensgefährliche Folgen mit sich bringen. Ein gutes Beispiel ist das Schlafmittel Zolpidem, das zu den sogenannten Z-Substanzen gehört. In Deutschland ist das Medikament in der Stärke zu 5 und 10 mg erhältlich. Eine von der US-Arzneimittelbehörde FDA durchgeführte Studie verdeutlicht, dass Frauen den Wirkstoff anscheinend deutlich langsamer als Männer abbauen. Denn 15 Prozent der Probandinnen hatten acht Stunden nach der Einnahme von 10 mg schnellfreisetzendem Zolpidem eine hohe Blutkonzentration erreicht, die in der Regel mit einer deutlichen Herabsetzung des Reaktionsvermögens einhergeht und beispielsweise zu Stürzen und Unfällen führen kann. Bei den Männern lag dieser Wert bei drei Prozent. Aufgrund dieser Ergebnisse setzte die FDA die zugelassene Dosis für Frauen bei schnell freisetzenden Zolpidempräparaten im Jahr 2013 von 10 auf 5 mg herab.
Ein Blick in die Fachinformation eines deutschen Zolpidem-Präparates zeigt, dass solche bedeutenden Aspekte nicht wiedergefunden werden. Denn dort heißt es weiterhin: „Die empfohlene Tagesdosis für Erwachsene beträgt 10 mg und wird abends unmittelbar vor dem Schlafengehen eingenommen. Es sollte die niedrigste wirksame Dosis von Zolpidem verwendet werden. Eine Tagesdosis von 10 mg darf nicht überschritten werden.“ Ein Geschlechterunterschied wird hier nicht berücksichtigt.
Gendermedizin im Klinik- und Apothekenalltag
Geschlechtsspezifische Unterschiede bei diversen Erkrankungen und Arzneimitteltherapien sind wissenschaftlich evident und kein aktueller Trend. Daher sollte ihnen im Berufsalltag mehr Beachtung geschenkt werden. Dazu ist es allerdings notwendig, dass sich dieses Wissen in den regulären Lehrbüchern und Lehrplänen wiederfindet. Bereits bei der Ausbildung des Nachwuchses an Universitäten und Lehrschulen sollten angehende Fachkräfte des Gesundheitswesens sensibilisiert werden, Aspekte der Gendermedizin in der medizinischen bzw. pharmazeutischen Versorgung zu berücksichtigen, damit circa 50 Prozent der Bevölkerung in der Therapie nicht benachteiligt werden.