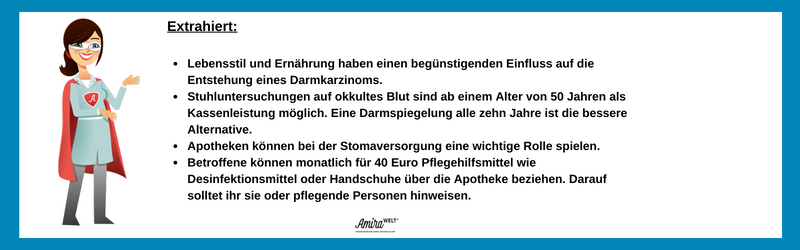Darmkrebs - auch die Apotheke kann helfen
Darmkrebs ist sowohl bei Männern als auch Frauen die dritthäufigste Krebserkrankung. Welche Früherkennungsmaßnahmen gibt es und welche Untersuchungen werden von den Krankenkassen erstattet? Ein Überblick.
Der menschliche Darm besteht aus dem Dünn- und Dickdarm. Im Dünndarm (Intestinum) wird die Nahrung verdaut, von hier aus gelangen die Nährstoffe in den Körper. Der Dünndarm wird vom Dickdarm (Kolon) umschlossen. Nachdem der Nahrungsbrei verdaut wurde, reguliert der Dickdarm den Flüssigkeitshaushalt des Körpers, indem er Wasser und Salze entzieht. Über den Enddarm (Rektum) werden die unverdauten Nahrungsreste dann Richtung After transportiert. Dieser physiologische Prozess kann durch Krebs- bzw. Tumorzellen, die sich aus gesunden Stammzellen der Darmschleimhaut bilden, gestört werden.
Wenn sich Krebszellen unkontrolliert aus gesunden Darmzellen vermehren, führt dies dazu, dass sie in umliegendes Gewebe einwachsen und es zerstören. Grund hierfür sind Mutationen im Erbmaterial – der DNA. Doch welche Ursachen gibt es und lässt sich Darmkrebs überhaupt vorbeugen?
Darmkrebs: Häufigkeit und Ursachen
Der Begriff Darmkrebs steht für Krebserkrankungen des Dickdarms (Kolonkarzinom) und des Enddarms (Rektumkarzinom). Zusammenfassend sprechen Expert:innen vom kolorektalen Karzinom. Das mittlere Erkrankungsalter liegt nach Daten der Deutschen Krebsgesellschaft bei Anfang bzw. Mitte 70 Jahren. Allerdings tritt die Erkrankung vermehrt ab dem 50. Lebensjahr auf.
Die genauen Ursachen, warum Darmkrebs auftritt, sind noch nicht eindeutig geklärt. Eins steht allerdings fest: Das Tumorrisiko wird weitgehend von Ernährung und Lebensstil beeinflusst. Aber auch genetische Faktoren spielen eine bedeutende Rolle.
Welche Risikofaktoren gibt es?
Tabakkonsum, Übergewicht, ballaststoffarme Ernährung, häufiger Konsum von Alkohol und rotem sowie verarbeitetem Fleisch zählen zu den wichtigsten Risikofaktoren. Verwandte ersten Grades von Patient:innen mit Darmkrebs haben außerdem ein hohes Risiko, auch einmal von der Erkrankung betroffen zu sein. Menschen mit seltenen Erbkrankheiten können sogar bereits in jüngeren Jahren erkranken. Zusätzlich können chronisch-entzündliche Darmerkrankungen – wenn auch in geringerem Umfang – das Erkrankungsrisiko erhöhen.
Um das Risiko eines Darmkrebses zu reduzieren, empfehlen Fachleute daher folgende Dinge:
- Regelmäßige Bewegung
- Übergewicht vermeiden
- Auf ballaststoffreiche Kost achten
- Tabak- und Alkoholkonsum vermeiden bzw. weitgehend zu reduzieren
- Den Konsum von rotem Fleisch und verarbeiteten Fleischprodukten minimieren
- Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen
Früherkennung und Vorsorgeuntersuchungen
Die rechtzeitige Erkennung von Darmkrebs ist sehr bedeutsam, denn dadurch können die Heilungschancen verbessert oder die Erkrankung sogar ganz verhindert werden. Alle Versicherten ab 50 Jahren können sich zwecks Früherkennung kostenlos untersuchen lassen. Zwischen 50 und 54 Jahren haben Versicherte außerdem Anspruch auf einen jährlichen Stuhltest. Eine Darmspiegelung ist noch zuverlässiger als dieser Test, daher wird Männern ab 50 und Frauen ab 55 empfohlen, diese Vorsorgeuntersuchung zu nutzen. Falls aus irgendeinem Grund keine Darmspiegelung infrage kommt, kann man jährlich (zwischen 50 und 54) bzw. alle zwei Jahre (ab 55) einen Stuhltest durchführen lassen.
Apothekenangestellte können – sofern sie bei Verdauungsproblemen um Rat gefragt werden – immer auch die Option „Darmspiegelung“ nennen, falls die Lebensqualität durch die Beschwerden zu sehr eingeschränkt wird. Ganz sicher gibt es bei einigen Personen Beschwerden oder Symptome, die eine solche Untersuchung ratsam erscheinen lassen.
Welche Symptome treten bei Darmkrebs auf?
Darmkrebs kann zunächst unbemerkt bleiben, da die Erkrankung im Anfangsstadium keine Beschwerden verursacht. Der Tumor wächst langsam, Betroffene spüren oft lange nichts davon – und wissen daher auch gar nicht, dass sie betroffen sind. Später beginnen die ersten Anzeichen aufzutreten, die Erkrankung wird „spürbar“.
Folgende Symptome können auftreten:
- Häufiger Stuhldrang und Obstipation oder ein Wechsel zwischen Obstipation und Diarrhoe
- Veränderung der Tageszeit der Toilettengänge
- Blut im Stuhl (schwarzer oder sehr dunkler Stuhl), Schleimbeimengungen, besonders übelriechender Stuhl oder bleistiftdünner Stuhl
- Starke Darmgeräusche und Blähungen; Blähungen mit ungewolltem Stuhlabgang, häufige Übelkeit oder Völlegefühle trotz geringer Nahrungszufuhr
- Schmerzen beim Stuhlgang und krampfartige Bauchschmerzen unabhängig vom Stuhlgang
- Verminderte Leistungsfähigkeit und häufige Müdigkeit
- Wiederholtes leichtes Fieber und Nachtschweiß
- Bei fortgeschrittenem Darmkrebs: Gewichtverlust, Übelkeit und Appetitlosigkeit

Künstlicher Darmausgang: Was ist wichtig bei der Stomaversorgung?
Bei Menschen mit Darmkrebs kann vorübergehend oder dauerhaft, abhängig von der medizinischen Indikation, ein künstlicher Darmausgang notwendig werden. Ein sogenanntes Stoma (griech. für „Mund, Mündung oder Öffnung“) erfüllt genau diese Funktion, bei dem der Stuhl oder der Harn künstlich abgeleitet werden. Es kommt es beispielsweise zum Einsatz, weil die physiologischen Darm-Prozesse durch den Tumor nicht mehr intakt sind oder aber wenn der Tumor an einer ungünstigen Stelle sitzt und es zu Komplikationen nach einer Operation gekommen ist. Zudem kann auch bei Personen mit bestimmten Darmerkrankungen ein Stoma erforderlich sein. Im Sanitätshaus, aber auch in der Apotheke finden sich unterschiedliche Produkte rund um die Stomaversorgung, die den Alltag der Betroffenen erleichtern.
Wenn Ausscheidungen des Darms nach außen über die Bauchwand geleitet werden sollen, sind sogenannte Basisplatten nötig. Über diese werden Stomabeutel an das Stoma angeschlossen. Um eine hygienische Stomaversorgung zu gewährleisten, müssen die Hilfsmittel regelmäßig gründlich gereinigt und desinfiziert werden. So kann Infektionen vorgebeugt werden. Geeignete Desinfektionsmittel finden sich in der Apotheke.
Pflegehilfsmittel zum Verbrauch
Wenn Angehörige zum Pflegefall werden, kannst du im Rahmen der Beratung darauf hinweisen, dass es Pflegehilfsmittel zum Verbrauch gibt, die zu Lasten der Krankenkassen abgerechnet werden können. Monatlich können dabei Pflegebedürftige über die Apotheke monatlich Pflegehilfsmittel in Höhe von 40,00 Euro (inkl. Mehrwertsteuer) beziehen. Zu ihnen gehören unter anderem Desinfektionsmittel für Hände und Flächen, Einmalhandschuhe, Mundschutz und Fingerlinge, Schutzbekleidung sowie saugende Bettschutzeinlagen. Voraussetzung hierfür ist, dass ein Pflegegrad von 1 bis 5 vorliegt und die Person sich in der häuslichen Pflege oder einer Wohngemeinschaft befindet. Den Anspruch auf Pflegehilfsmittel regelt das Sozialgesetzbuch (SGB XI §40). Den Antrag zur Kostenübernahme müssen die Betroffenen bei ihrer Krankenkasse einreichen.
Der Patient bzw. die Patientin – bzw. je nach Schweregrad der Erkrankung die gesetzliche Vertretung – kann sich in der Apotheke die Produkte aussuchen, die benötigt werden. Wichtig ist jedoch, dass die 40,00 Euro nicht überschritten werden. Ansonsten muss die Differenz bezahlt werden. Zudem sollte die Apotheke im Hinblick auf die korrekte Abrechnung beachten, dass es Höchstpreise für die einzelnen Produkte gibt. Auch ist es in der Regel so, dass Apotheken, die Pflegehilfsmittel abgeben, bestimmten Lieferverträgen beigetreten sein müssen.
Du brauchst in der Apotheke weitere Infos für die Darmkrebs-Beratung?
Apothekenmitarbeitende betreuen hin und wieder auch Darmkrebs-Patient:innen mit Hilfsmitteln. Gut zu wissen: Das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) stellt evidenzbasierte und unabhängige Informationen zur Verfügung und unterstützt bei der Recherche, falls Patient:innen mal Rat in der Apotheke suchen und ihr mehr Informationen braucht. Den Service kannst du in der Apotheke montags bis freitags telefonisch oder per E-Mail in Anspruch nehmen.