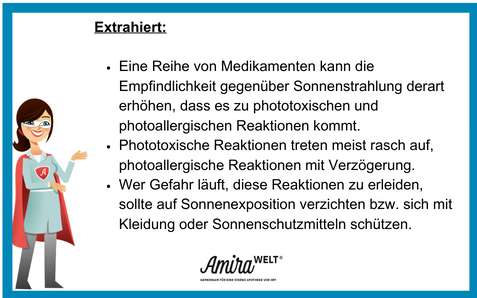Wenn Medikamente „Sonnenbrand“ hervorrufen
Die Sonne scheint, die Temperaturen laden dazu ein, seine Zeit leicht bekleidet im Freien zu verbringen. Doch das kann für Menschen, die bestimmte Medikamente einnehmen, unangenehme Folgen haben. AMIRA zeigt, welche Arzneimittel bei Sonnenbestrahlung Probleme bereiten können.
Es gibt eine ganze Reihe von Medikamenten, die phototoxische und photoallergische Reaktionen als unerwünschte Azneimittelwirkung auslösen. Diese Substanzen werden unter dem Oberbegriff „Photosensibilisatoren“ zusammengefasst. Dadurch hervorgerufene phototoxische Reaktionen sind dosisabhängig und können von Mensch zu Mensch erheblich variieren. Wer wie stark reagiert hängt von den photosensibilisierenden Substanzen selbst, ihrem Metabolismus im Körper und den Eigenschaften der Haut ab.
Folgende Faktoren sind für die Wirkung von Photosensibilisatoren relevant:
- Art der Applikation
- Konzentration in der Haut
- Vehikel bzw. Hilfsstoff
- Chemische und physikalische Eigenschaften
- Dosis der UV-Strahlung
Gelangt ein Photosensibilisator von außen in die Haut, sind aufgrund des Konzentrationsgefälles die Schäden in den oberen Hautschichten besonders ausgeprägt. Dagegen verursacht ein über den Blutweg in die Haut gelangender Photosensibilisator vorwiegend Veränderungen in tieferen Hautschichten.
Zu den Arzneimitteln, die mit einer Empfindlichkeit gegenüber UV-Licht assoziiert sind, zählen unter anderem:
- Diuretika, wie HCT, Furosemid, Triamteren
- Kardiovaskulär wirksame Substanzen, wie Amiodaron, Captopril, Enalapril
- Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR)Ibuprofen, Ketoprofen, Naproxen
- Antibiotika wie Docxcyclin, Tetracyclin, Ciprofloxacin
- Retinoide wie Acitretin, Isotretinoin
- Antidepressiva wie Amitriptylin, Clomipramin
Auch einige OTC-Medikamente – wie zum Beispiel Antihistaminika wie Cetirizin und Loratadin, antifungale Wirkstoffe wie Terbinafin, einige Duftstoffe in Kosmetika und paradoxerweise auch bestimmte UV-Absorber, wie Paraaminobenzoesäure, Benzophenon-3, Benzoylmethane oder Zimtsäureester in Sonnenschutzmitteln – können die Photosensitivität der Haut erhöhen.
Unterschiede „phototoxisch“ zu „photoallergisch“
Phototoxische Reaktionen können innerhalb von Minuten oder Stunden nach der erstmaligen Applikation auftreten. Die Symptome ähneln einem Sonnenbrand. Sie reichen von geröteter Haut bis zur Blasenbildung. Derartige Reaktionen können nicht nur durch Medikamente, sondern auch durch Chemikalien sowie durch den Kontakt mit Pflanzen ausgelöst werden. Gefahr besteht etwa bei der sogenannten Herkulesstaude oder dem Diptambusch, der in Deutschland allerdings selten vorkommt.
Wie die Pathophysiologie dieser Prozesse beschaffen ist, darüber gibt es zwei unterschiedliche Theorien. Die eine besagt, dass die Moleküle eines Wirkstoffs aufgrund des absorbierten UV-A Lichts in einen höheren Energiezustand übergehen und mit Zellbestandteilen interagieren bzw. diese schädigen, dann aber wieder relativ rasch ihr vorheriges Energieniveau einnehmen. Die andere besagt, dass durch die Strahlung stabile Produkte gebildet werden, die an die DNA der Zellen binden und diese schädigen. Diskutiert wird auch, dass die Photosensibilisierung bestimmte Arten des weißen Hautkrebses fördert.
Photoallergische Reaktionen werden durch das Immunsystem vermittelt. Bei erneuter Exposition mit dem Arzneistoff kommt es zu einer T-Zell-vermittelten Typ-IV-Reaktion (Spättyp-Reaktion). Dabei werden proinflammatorische Zytokine freigesetzt, die in der Haut zu Entzündungen und Ekzembildung, ähnlich einer Dermatitis, führen. Photoallergisch bedingte Reaktionen treten meistens mit einer Verzögerung von einem bis drei Tagen nach der Applikation auf. Sie können auch in Bereichen sichtbar werden, die nicht der Sonne ausgesetzt waren.
Zu den Photoallergenen zählen einige Topika wie beispielsweise:
- NSAR (z. B. Ketoprofen, Piroxicam, Diclofenac),
- Benzocain (als Lokalanästhetikum) oder
- Chlorhexidin.
Viele Hautreaktionen durch UV-Licht treten erst durch die Interaktion mehrerer Medikamente auf. Das bedeutet, dass möglicherweise erst die Kombination zweier Medikamente die Haut photosensitiv macht, während die Anwendung nur eines dieser Medikamente folgenlos bleibt. Patienten mit Polymedikation können also besonders gefährdet sein. OTC-Präparate, die zusätzlich zur Dauermedikation genommen werden, können das Risiko für Lichtreaktionen ebenfalls punktuell erhöhen.
Tipps für die Beratung
Gibst du Medikamente aus, die das Risiko einer der oben beschriebenen Reaktionen erhöhen, weise deine Patienten darauf unbedingt hin. Diese sollten ihre Sonnen-Exposition dann kontrollieren bzw. reduzieren, also nicht zwischen 11 und 15 Uhr rausgehen, Sonnenschutzmittel nutzen oder die Haut durch Kleidung vor Bestrahlung schützen. Solariumbesuche sind ebenso tabu. Eventuell lässt sich die Einnahme eines photosensibilisierenden Medikaments auch in die Abendstunden verlegen.
AMIRA fragt: Habt ihr in eurer Offizin schon von phototoxischen oder -allergischen Reaktionen nach Medikamenteneinnahme gehört? Was habt ihr geraten? Und stehen manchmal Patienten vor euch, die entsprechende Hautreaktionen nach Pflanzenkontakt zeigen?