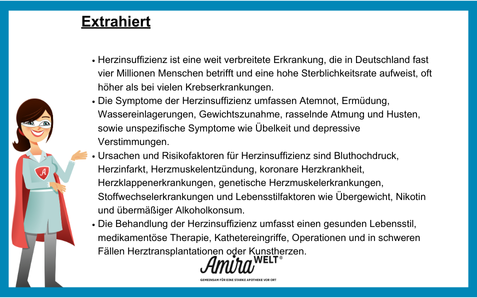Herzinsuffizienz: Wenn die Pumpe zu schwach ist
Eine Herzinsuffizienz, auch Herzschwäche genannt, gilt als Epidemie des 21. Jahrhunderts. In Deutschland leiden mittlerweile fast vier Millionen Menschen daran und täglich werden es mehr. Das ist wichtig zu wissen.
Krankheitsbild Herzinsuffizienz
Die Herzinsuffizienz ist die häufigste Diagnose, die zu einer stationären Krankenhauseinweisung führt. Meist hat sie eine ernstzunehmende Prognose, denn die Sterblichkeitsrate infolge einer Herzschwäche ist sogar höher als bei vielen Krebserkrankungen. Klinisch liegt eine Funktionsstörung des Herzens vor. Es ist nicht mehr in der Lage, den Körper und damit auch die Organe wie Gehirn, Muskeln, Leber und Nieren mit ausreichend Blut und damit mit ausreichend Sauerstoff zu versorgen.
Verschiedene Einteilungen
Es gibt verschiedene Unterscheidungsmöglichkeiten der Herzinsuffizienz. Je nach Schweregrad kann die Herzschwäche in vier unterschiedliche Stadien (NYHA I bis IV) je nachdem, ob die Beschwerden nur unter Belastung oder auch bereits in Ruhe auftreten. Auch die American Heart Association (AHA) hat eine derartige Einteilung in die Stadien A bis D. Weiterhin kann die Herzschwäche nach ihrer Lokalisation in Rechtsherzinsuffizienz, Linksherzinsuffizienz oder globale Herzinsuffizienz (gesamtes Herz betroffen) eingeteilt werden.
Betrachtet man den Krankheitsverlauf kann die akute Herzinsuffizienz (nach Herzinfarkt, Myokarditis, Perikardtamponade, etc.) und die chronische Herzinsuffizienz, die sich im Lauf von Monaten oder Jahren entwickelt unterschieden werden. Nach Pathomechanismus lassen sich die systolische Herzinsuffizienz, bei der das Herz durch die geschwächte Pumpleistung nicht mehr genug Blut in den Körper pumpen kann, sowie die diastolische Herzinsuffizienz unterscheiden. Hier können die steif gewordenen Herzkammern sich nicht ausreichend dehnen und entspannen, sodass sie nicht genügend Blut aufnehmen können. Weiterhin kann nach Hämodynamik (Vorwärtsversagen – Rückwärtsversagen), Herzzeitvolumen (Low-Output-Failure – High-Output-Failure) oder Pathophysiologie (unterschiedliche prozentuale Ejektionsfraktionen des Herzens) eingeteilt werden.
Diese Symptome treten auf
Da es bei eingeschränkter Pumpfunktion des Herzens immer schwieriger für den Körper wird, seine Organe ausreichend mit Blut und Sauerstoff zu versorgen, kommt es vor allem zu Symptomen wie Atemnot und Ermüdungserscheinungen. Je fortgeschrittener das Stadium der Herzinsuffizienz ist, desto ausgeprägter sind die Symptome. Anfangs entsteht die Kurzatmigkeit nur bei körperlicher Anstrengung, später auch in völliger Ruhe. Aber auch Wassereinlagerungen (Ödeme), vor allem in den Beinen, eine plötzliche Gewichtszunahme von mehr als 0,5 kg am Tag und mehr als 2 kg pro Woche, rasselnde Atmung und Husten mit schaumigem Schleim, sowie nächtlicher Harndrang sind typische Symptome einer Herzschwäche. Auch unspezifische wie leichte Übelkeit, Appetitlosigkeit oder depressive Verstimmungen können hinzukommen.
Ursachen und Risikofaktoren
Meistens entwickelt sich eine Herzinsuffizienz infolge eines Bluthochdrucks, eines Herzinfarkts, einer Herzmuskelentzündung oder einer koronaren Herzkrankheit (Verkalkung der Herzkranzgefäße). Aber auch Herzklappenerkrankungen, angeborene Herzfehler, genetisch bedingte Herzmuskelerkrankungen (z. B. Kardiomyopathie) sowie langjährige Herzrhythmusstörungen (z. B. Vorhofflimmern) können eine Herzschwäche verursachen. Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes mellitus oder Schilddrüsenerkrankungen können ebenfalls eine Rolle spielen. Einige Risikofaktoren hat jedoch jeder in der eigenen Hand: Übergewicht, Nikotin und übermäßiger Alkoholkonsum schädigen nachgewiesenermaßen das Herz.
Behandlung der Herzinsuffizienz
So vielzählig die Formen und Ausprägungen der Herzinsuffizienz sein können, so individuell ist ihre Therapie. Meist wird die Diagnose beim Hausarzt oder der Hausärztin gestellt, der dann weiter an eine kardiologische Fachpraxis überweist. Die Therapie richtet sich nach dem Schweregrad der Herzinsuffizienz, am Alter und am Allgemeinzustand des Patienten sowie an dessen Vorerkrankungen.
Ein gesundheitsfördernder Lebensstil mit einer herzgesunden Ernährung, einer gewissen körperlichen Fitness und ein gewissenhafter Umgang mit Genussmitteln wie Alkohol sollte unbedingt befolgt werden. Wichtigster Ansatz für die Behandlung einer Herzschwäche ist die medikamentöse Therapie. Sehr häufig werden Wirkstoffe aus der Gruppe der ACE-Hemmer (z. B. Ramipril, Enalapril) und Betablocker (z. B. Metoprolol) eingesetzt. Sie dienen der Blutdrucksenkung und verringern die Anspannung der Gefäßmuskulatur. Werden ACE-Hemmer nicht vertragen, können auch Sartane (z. B. Candesartan, Valsartan), Neprilysin-Hemmer (z. B. Sacubitril in Kombination mit Valsartan in Entresto®).
Ist nach der Einnahme von Betablockern der Herzschlag zu schnell oder werden diese nicht vertragen, kann stattdessen ein IF-Kanalblocker (z. B. Ivabradin) verordnet werden. Zur Entlastung des Herzens durch höhere Wasserausscheidung werden Mineralokortikoid-Rezeptorantagonisten (z. B. Spironolacton, Eplerenon) meist in allen vier NYHA-Stadien eingesetzt. Um Ödeme im Körper auszuschwemmen, werden Diuretika wie Furosemid, Torasemid oder auch Hydrochlorothiazid gegeben.
Wenn sich die Herzschwäche trotz einer gesunden Lebensweise und einer medikamentösen Therapie verschlechtert, können Kathetereingriffe oder auch Operationen unumgänglich werden. Bei einer kardialen Resynchronisationstherapie (CRT) wird ein spezieller Herzschrittmacher eingesetzt, der eine sogenannte Reizleitungsstörung korrigiert. Durch die Implantation eines Mini-Defibrillators kann bei starken Herzrhythmusstörungen der plötzliche Herztod verhindert werden. Verengte Herzkranzgefäße können mit Gefäßprothesen (Stent oder Bypass) wirksam behandelt werden. Bei schweren Verläufen kann eine Herztransplantation oder zur Zeitüberbrückung das Einsetzen eines Kunstherzes erforderlich sein.
Kann einer Herzinsuffizienz vorgebeugt werden?
Ein gesunder Lebensstil kann nicht nur vor einer Herzschwäche, sondern auch vor vielen Erkrankungen wirkungsvoll schützen. Dazu sollte fünfmal pro Woche für mindestens 30 Minuten die Ausdauer trainiert werden. Erlaubt ist, was Spaß macht. Auch der stramme Spaziergang an der frischen Luft oder die Treppe statt dem Fahrstuhl sind effektiv. Eine gesunde und ausgewogene Ernährung mit viel Gemüse, Obst und Fisch sowie wenig Fleisch, Zucker und Salz erleichtert es, das Normalgewicht zu erreichen und dieses auch zu halten. Alkohol sollte nur in Maßen genossen und auf Nikotin sollte gänzlich verzichtet werden. Dauerstress muss vermieden werden und regelmäßige Entspannungspausen dürfen im Alltag nicht fehlen.
Weiterhin sollten regelmäßig Check-up-Untersuchungen in der hausärztlichen Praxis wahrgenommen werden, sodass Erkrankungen wie Bluthochdruck oder Herzrhythmusstörungen, die zu einer Herzinsuffizienz führen können, möglichst frühzeitig erkannt und behandelt werden können.