Mixen statt mühen – Rezepturhilfe auf Knopfdruck
Rezepturarbeit mit einem Küchengerät? Der DAC/NRF zeigt im aktuellen Rezepturtipp, wie die Hydrocortison-Suspension dank Stabmixer schneller und einfacher gelingt – ganz ohne Klümpchen und Chaos.
Dank Stabmixer: Hydrocortison-Suspension effizienter herstellen
Hast du dich im Rezepturalltag nicht auch schon mal gefragt, ob es nicht einfacher ginge? Wenn sich Pulver schlecht einarbeiten lassen, alles klumpt und man gefühlt ewig anreibt – da liegt die Versuchung nahe, sich aus der Küche inspirieren zu lassen. Für alle, die heimlich vom Thermomix (oder Generika) in der Rezeptur träumen, gibt es gute Nachrichten: Das DAC/NRF erlaubt in einem aktuellen Rezepturtipp die Verwendung eines Stabmixers bei der Herstellung der Hydrocortison-Suspension 1 mg/ml / 10 mg/ml (NRF 34.2.) – und spart damit tatsächlich Zeit und Aufwand.
Originalvorschrift: Aufwendig und fehleranfällig
Wer die Hydrocortison-Suspension nach NRF 34.2. bereits hergestellt hat, weiß: Die klassische Vorgehensweise ist komplex. Hochdisperses Siliciumdioxid und Hydrocortison müssen zunächst getrennt voneinander in zwei unterschiedlichen Arbeitsgängen angerieben werden, ehe sie schrittweise mit der Grundlage verarbeitet werden dürfen. Besonders bei größeren Ansätzen steigt das Risiko für Klümpchenbildung an, die durch eine Herangehensweise an die Rezeptur bedingt sind, vor allem wenn der Herstellende versucht Zeit zu sparen und alles gemeinsam verarbeitet – trotz anderslautender NRF-Vorschrift.
Der Stabmixer als Gamechanger?
Der neue Rezepturtipp schlägt eine deutlich einfachere Alternative vor – zumindest für die Variante mit 1 mg/ml Hydrocortison. Hier darf die Ein-Topf-Methode mit dem Stabmixer angewendet werden: Alle Bestandteile werden in einem Becherglas gemischt, das Rührwerk vollständig eingetaucht – und los geht‘s. Wichtig zu beachten: Das Becherglas sollte so dimensioniert sein, dass der Ansatz maximal etwa zwei Drittel des Gesamtvolumens ausfüllt. Gleichzeitig muss der Flüssigkeitsspiegel hoch genug sein, damit das Rührwerk des Stabmixers vollständig in die Zubereitung eintauchen kann. Bereits zwei Minuten bei niedriger Geschwindigkeit reichen bei Kleinansätzen meist aus. Ein kurzer Blick durch den Boden des Becherglases zeigt, ob noch Pulverklümpchen vorhanden sind. Die Technik ist bereits bei Ansätzen ab 50 ml erlaubt (wobei hier allerdings wohl kaum ein Rührwerk vollständig eingetaucht werden kann), ab 200 ml wird sie sogar empfohlen.
Explizit schreibt das DAC/NRF hier zwar keine Mehreinwaage vor, empfohlen wird an dieser Stelle aber mit 10 % Mehreinwaage zu rechnen, da vermutlich ein Verlust durch die Verwendung des Rührwerks und durch das Anhaften der Rezeptur an den Wänden des Becherglases auftritt. Würde man sie klassisch in der Glasfantaschale mit Pistill herstellen, dann sind die Reste mit dem Kartenblatt einfacher herauszukratzen.
Vorsicht bei der 10 mg/mL-Variante
Nicht geeignet ist der Stabmixer dagegen bei 500-ml-Ansätzen der 10 mg/ml-Konzentration. Hier kam es laut DAC/NRF zu starker Schaumbildung und Klumpen durch Agglomeratbildung. Für diese Variante soll die Grundlage deshalb portionsweise in etwa 100-ml-Schritten zu den vorgelegten Feststoffen gegeben und untergerührt werden – was also keine echte zeitliche Erleichterung bringt.
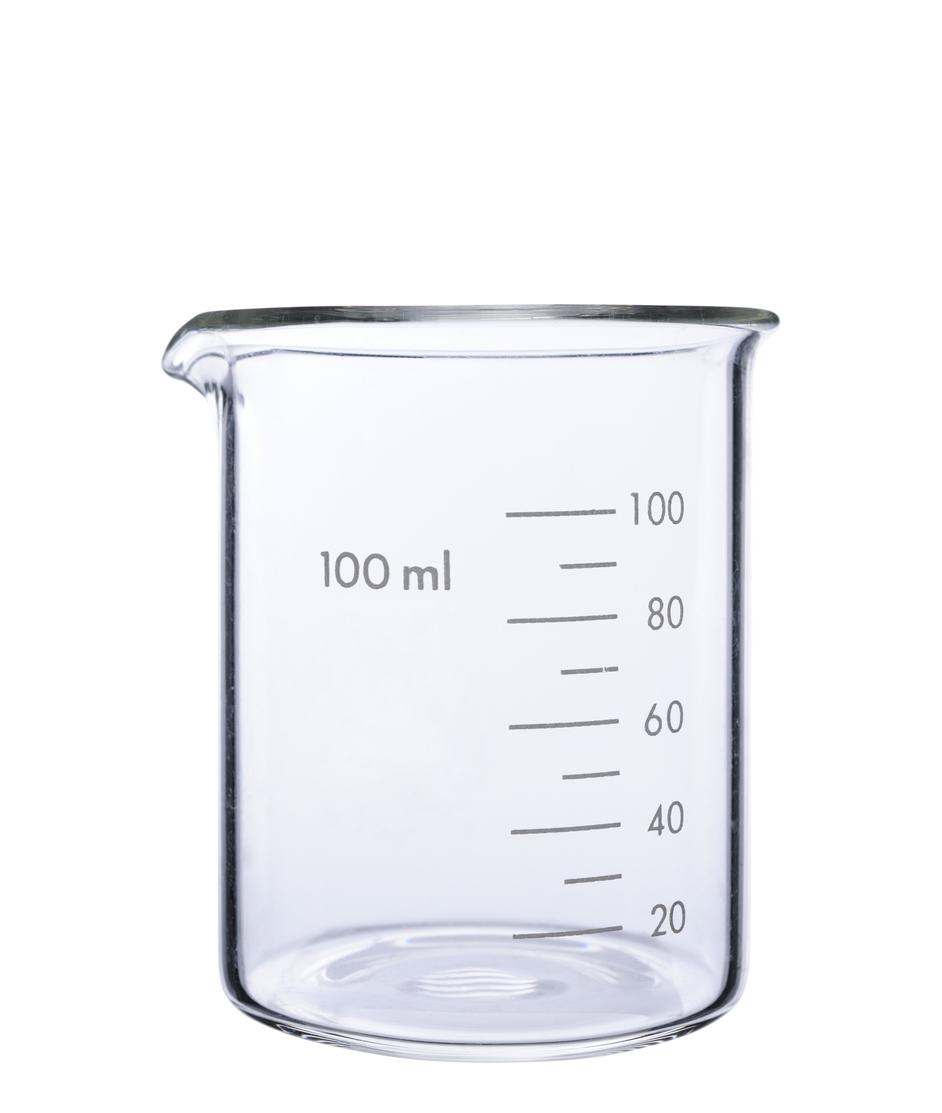
(Quelle: istock/kyoshino) Für die Variante mit 500-ml-Ansätzen der 10 mg/ml-Konzentration ist der Stabmixer ungeeignet. Daher soll die Grundlage portionsweise in etwa 100-ml-Schritten zu den vorgelegten Feststoffen gegeben und untergerührt werden.
Warum die klassische Methode ablösen?
Die klassische Methode ist geprüft und funktioniert in der Regel gut, wenn man sich genau an die Vorgaben hält. Wieso also sollte man ein funktionierendes System verändern? Zunächst einmal liegt der Zeitgewinn auf der Hand: Während die klassische Rezeptur viele einzelne Anreib-, Aufstock- und Rührschritte verlangt, läuft bei der Ein-Topf-Methode vieles parallel – besonders bei größeren Volumina. Die Reinigung des Stabmixers im Anschluss an die Rezepturherstellung verläuft ebenfalls zügiger als das Säubern mehrerer Fantaschalen und dazugehöriger Pistille. Auch das Risiko für Fehler bei der Reihenfolge, die dann in einer klumpigen Rezeptur enden entfällt.
Wer sich aufgrund des Stabmixer- Einsatzes aber ungläubig die Augen reibt, der hat verpasst, dass diese Rezeptur nicht der erste Mixer-Fall ist, den das DAC/NRF präsentiert. Im Gegenteil stellt er keine einmalige Ausnahme dar, das zeigt ein Blick in andere NRF-Vorschriften: Schon bei der Herstellung der Sildenafil-Suspension 10 mg/ml (NRF 10.7.) oder der Spironolacton-Suspension 5 mg/ml (NRF 26.5.) wird die Verwendung eines Stabmixers empfohlen. Die Herstellung der Suspensionen erfolgt dabei ebenfalls im Ein-Topf-Ansatz direkt im Becherglas – ohne separates Anreiben oder Umfüllen der Einzelkomponenten.
AMIRA fragt: Hast du auch schon einmal überlegt, andere Rezepturen mit dem Stabmixer oder gar anderen Küchengeräten herzustellen? Schreib uns gern in die Kommentare, welche Rezeptur dir als nächstes für diese Methode sinnvoll erscheint. Wir sind gespannt auf deine Erfahrungen!



