Heißer Dampf, klare Fakten: Richtig inhalieren
Inhalieren hilft bei akuten und chronischen Atemwegserkrankungen – aber nur, wenn es richtig gemacht wird. Was wirklich wirkt, was gefährlich sein kann und welche Geräte sich eignen, erfährst du hier.
Mythen rund ums Inhalieren
Leider hören wir in der Apotheke immer noch häufig, dass Kund:innen versuchen, eine Salzinhalation mit einem Kochtopf durchzuführen. Auch wenn dies gelegentlich von Ärzt:innen empfohlen wird, funktioniert es nicht – und hat auch nie funktioniert. Aufgrund der hohen Siedetemperatur von Natriumchlorid verdampft lediglich das Wasser, während das Kochsalz im Topf zurückbleibt.
Der heiße Wasserdampf (circa 80 °C) durchwärmt die Gesichts- und Stirnpartie, was bei bestehenden Entzündungen kritisch sein kann. Dennoch empfinden viele diese Art der Inhalation als angenehm; ein warmes Kirschkernkissen, eine Rotlichtlampe oder warme Umschläge haben jedoch einen ähnlichen Effekt. Bei Kindern oder kognitiv beeinträchtigten Personen besteht Verbrühungsgefahr. Solche Inhalationen sollten daher nur unter Aufsicht erfolgen.
Kräuter und ätherische Öle – sinnvoll oder riskant?
Wird heißem Wasser Kamille, Thymian, Fenchel oder ätherische Öle (z. B. Thymianöl, Eukalyptusöl, Pfefferminzöl, Kiefernadelöl; auch in Form eines Erkältungsbalsams möglich) hinzugefügt, kann dies eine schleimlösende und entzündungshemmende Wirkung im Nasen- und Rachenraum entfalten. Bis in die Lungenbläschen gelangt das Inhalat jedoch nicht, die Partikel sind schlicht zu groß. Für diese Anwendung empfehlen sich einfache Inhalatoren aus Kunststoff.

Foto: istock/Esin Deniz
Stark allergene Zusätze wie Teebaumöl sollten, wenn überhaupt, nur stark verdünnt verwendet werden. Die Inhalationsdauer sollte etwa zehn Minuten nicht überschreiten. Meist ist die Flüssigkeit dann ohnehin so weit abgekühlt, dass kein Dampf mehr aufsteigt. Für Menschen mit Asthma oder Kinder unter sechs Jahren ist die Dampfinhalation mit ätherischen Ölen nicht geeignet, da sie Asthmaanfälle oder Kehlkopfkrämpfe auslösen kann.
In Duftlampen oder Diffusoren können ätherische Öle in geringerer Konzentration über die Raumluft verdampft werden. Das Babix® Inhalat (Eukalyptusöl und Fichtennadelöl) von Mickan kann bereits ab dem Säuglingsalter auf Kleidung oder ein Tuch im Schlafraum aufgetropft werden. Das Eucabal® Inhalat (ebenfalls Eukalyptus- und Fichtennadelöl) von Aristo darf ab zwei Jahren auf Kleidung gegeben oder ab sechs Jahren in Wasserdampf inhaliert werden.
Salzinhalation – aber richtig!
Wer nicht am Meer spazieren gehen kann, braucht für eine wirksame Salzinhalation einen elektrischen Vernebler. Verwendet wird sterile, meist isotonische Kochsalzlösung in praktischen Einzelampullen, z. B. Pari® Inhalationslösung, Kochsalz 0,9 % Inhalat Paedia, Isotone Kochsalzlösung 0,9 % Miniplasco Connect von B. Braun.
Diese Lösungen dienen primär der Befeuchtung der Atemwege. Zur Schleimlösung wird häufig eine hypertone Kochsalzlösung mit 3 % Wirkstoffgehalt verwendet – bei Lungenerkrankungen auch 5 % oder 6 % (z. B. MucoClear 3% (ProtECT), MucoClear 6% von Pari, Natriumchlorid 5,85 % Braun Mini-Plasco® Connect).
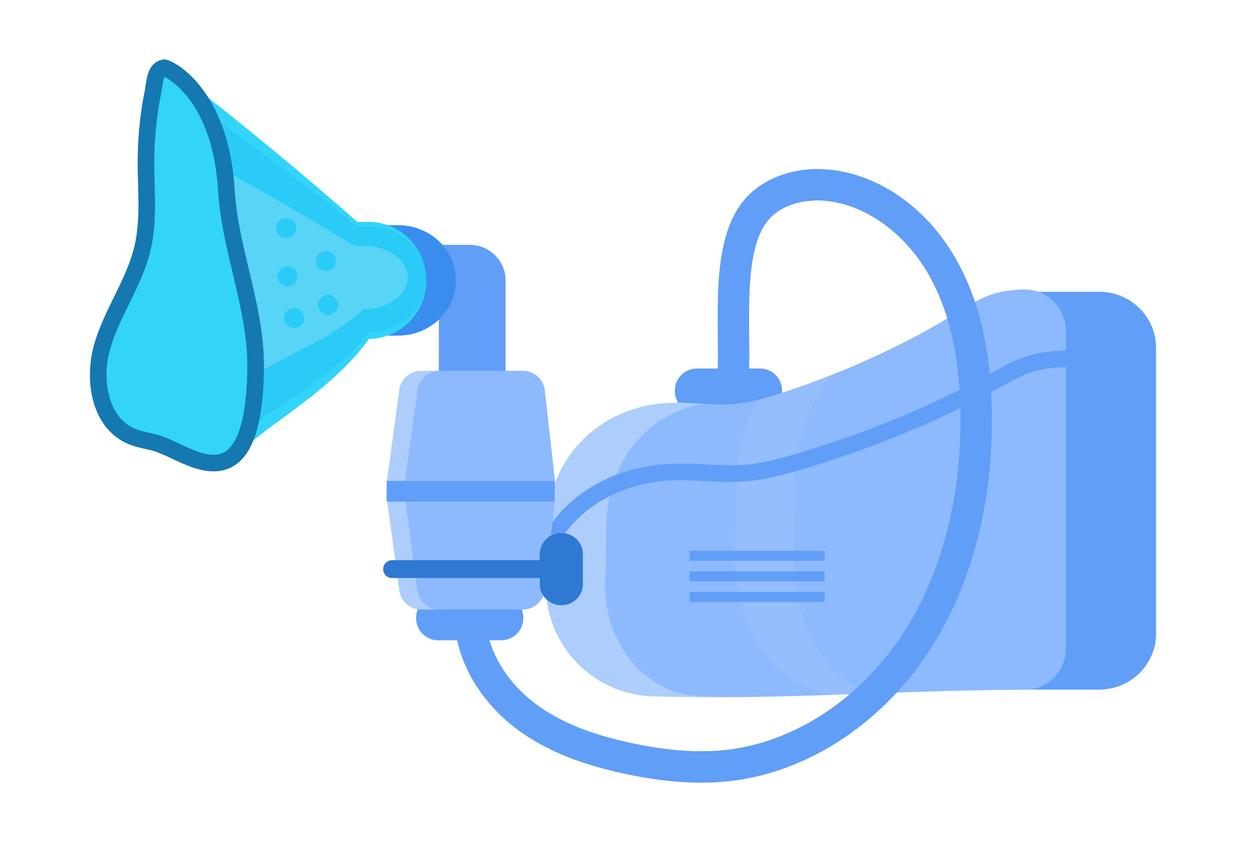
Foto: istock/Yuliya Baranych
Geräte und Technik: Was eignet sich für wen?
Unterschieden werden Ultraschall-, Druckluft- und Membranvernebler. Anbieter sind z. B. PARI GmbH (Pari® Compact 2, Pari® Free), Sidroga/Emser® (Inhalator Compact) oder Omron (Omron® Compact, Omron® X102 Total, Omron® Mini Air 360+).
Die Tröpfchengröße kann genau bestimmt werden, so lassen sich gezielt die oberen, mittleren oder unteren Atemwege erreichen. Die Geräte eignen sich daher für viele Erkrankungen und auch für die Gabe von Medikamenten per Feuchtinhalation (z. B. Kortikoide oder β2-Sympathomimetika). Da keine spezielle Atemtechnik erforderlich ist – anders als bei Dosieraerosolen oder Pulverinhalatoren – sind diese Geräte auch für Babys und Kleinkinder geeignet. Es gibt spezielle Zubehörsets mit Atemmasken in verschiedenen Größen und Vernebler für unterschiedliche Partikelgrößen.



