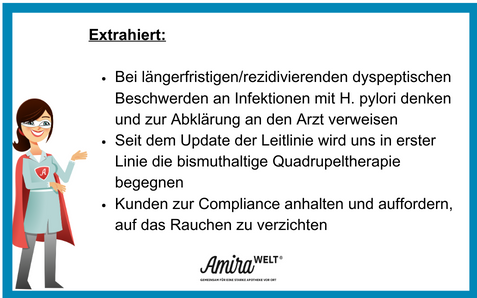Helicobacter pylori – ein bemerkenswerter Keim
Im Apothekenalltag begegnen uns regelmäßig Kunden, die ein Rezept für eine Eradikationstherapie eines H. pylori einlösen. Doch was hat es mit diesem Keim genau auf sich?
Die H. pylori-Infektion zählt zu den häufigsten auftretenden bakteriellen Infektionskrankheiten. Es handelt sich dabei laut der S2K Leitlinie „Heliocbacter pylori und gastroduodenale Ulkuskrankheit“ um eine bakterielle Erkrankung des Magens, unabhängig von Symptomen oder klinischem Erscheinungsbild.
Liegt ein positiver Test auf H. pylori und damit eine nachgewiesene Infektion vor, so gilt dies als Indikation für eine Therapie. Dabei ist es seit dem Update der Leitlinie unerheblich, ob Symptome auftreten oder nicht. In beiden Fällen wird heutzutage eine Eradikationstherapie eingeleitet.
Symptome und Übertragungsweg von H.pylori
Der Keim steht im Zusammenhang mit einer chronischen aktiven Gastritis. Er kann dyspeptische Beschwerden, wie Sodbrennen, Magenschmerzen, Appetitlosigkeit, Übelkeit und Erbrechen hervorrufen. Aus diesem Grund sollte bei Kunden, die über derartige Symptome klagen auch immer an eine mögliche Infektion mit H.pylori gedacht und der Kunde nötigenfalls an einen Arzt verwiesen werden. Auch Folgeerkrankungen sind nicht zu unterschätzen. Neben der Gefahr von Komplikationen kann es zur gastroduodenalen Ulkuskrankeit kommen. Zudem gilt H. pylori als wesentlicher Risikofaktor für Magenkarzinome.
Der genaue Übertragungsweg von H. pylori ist nicht ganz klar. Eine Ansteckung geschieht jedoch von Mensch zu Mensch und das oft bereits in der Kindheit durch engen Kontakt zu infizierten Angehörigen. Spätere Übertragungen, etwa zwischen Partnern, kommen hingegen selten vor. Allerdings wird auch eine Übertragbarkeit durch kontaminierte Lebensmittel oder Trinkwasser angenommen.
Entdeckung nach Selbstversuch
Medizinhistorisch interessant ist, dass man lange Zeit annahm, im sauren Milieu des Magens könnten Bakterien nicht überleben. Geschwüre und Magenschleimhautentzündungen, so die Vermutung, würden durch Stress, scharfe Speisen oder Störungen der Magensäureproduktion hervorgerufen. Therapeutisch rückte man den Beschwerden durch Verabreichung von Antazida und Magensäureblockern zu Leibe, in späteren Stadien durch operative Eingriffe. Dann kamen im Jahr 1983 die beiden australischen Wissenschaftler John Robin Warren und Barry Marshall und behaupteten, dass der Verursacher dieser weit verbreiteten Krankheiten ein Bakterium ist, das folglich durch die Gabe von Antibiotika zu behandeln sei. Die Fachwelt blieb skeptisch. Marshall machte deshalb einen Selbstversuch: Er nahm eine Flüssigkeit mit mehreren Milliarden Helicobacter-Keimen zu sich und entwickelte kurz darauf eine Gastritis, die er mit der Einnahme eines Antibiotikums heilen konnte. 2005 erhielten Marshall und Warren für ihre Arbeit den Nobelpreis für Physiologie, den sogenannten Medizin-Nobelpreis.
Therapie des H. pylori
Wurde der Keim einmal erfolgreich eradiziert, kommen Reinfektionen kaum mehr vor. Zusätzlich sinkt das Risiko für Magenkarzinome und andere gastroduodenale Krankheiten.
Damit die Therapie erfolgreich sein kann, ist es ratsam, dem Kunden einige Ratschläge mit auf den Weg zu geben. Sehr wichtig ist die Compliance des Patienten, dazu sollte er nicht rauchen. Der verschreibende Arzt wird zusätzlich darauf achten, dass die Säurehemmung in einem optimalen Maß stattfindet. Sie ist maßgeblich für die Wirksamkeit von Amoxicillin und Clarithromycin. Dies geschieht durch die entsprechende Auswahl, Dosierung und Einnahmehäufigkeit des Protonenpumpenhemmers. Allerdings ist es fraglich, in wie weit diese beiden Antibiotika zukünftig noch Verwendung bei der Eradikationstherapie finden werden, da gerade die Resistenzen gegenüber Clarithromycin zugenommen haben. Darum empfiehlt die Leitlinie in der Erstlinientherapie mittlerweile die bismuthaltige Quadrupeltherapie über einen Zeitraum von zehn Tagen. Sie besteht aus PPI, Bismut-Kalium-Salz 140 mg, Tetracyclin 125 mg und Metronidazol 125 mg.