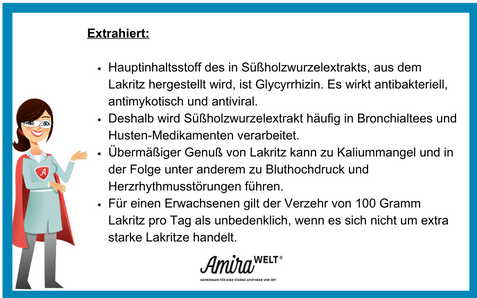Lakritze – schwarzes Gold oder schwarzes Gift?
Lakritz oder Salmiak polarisieren: Die einen lieben das schwarze Gold, andere ekeln sich regelrecht davor und bezeichnen es schon mal als „Bärendreck“. Warum wir bei der Beratung hellhörig sein sollten.
Lakritze oder Lakritz (lat. liquiritia) bezeichnet den zu einem Saft eingedickten Wurzelextrakt des echten Süßholzes (lat. Glycyrrhiza glabra). Der Wurzelsaft hat die 150-fache Süßkraft von Rohrzucker. Auch für Produkte aus Süßholzbasis wird oft der Begriff Lakritz(e) verwendet. Enthalten die Zubereitungen zusätzlich noch Ammoniumchlorid (= Salmiaksalz), so spricht man von Salmiak(pastillen) oder Salmiaklakritz. Während Lakritze eher süß schmeckt, ist Salmiak kräftiger und herber.
In vielen Hustensäften oder Lutschpastillen ist Süßholzextrakt enthalten. Aber auch in Form von Pastillen, Dragees und Bonbons wird Lakritze nachgefragt. Liebhaber kaufen meist gleich drei oder vier Packungen. Auch in alkoholischen oder nichtalkoholischen Getränken ist es enthalten und in manchen Ländern sehr beliebt. Aber wie wirkt Lakritze in unserem Körper? Ist sie gesund oder kann ein übermäßiger Verzehr auch schaden?
Heilsamer Wurzelextrakt
Der Hauptinhaltsstoff von Lakritze ist das Glycyrrhizin. Dieses wirkt antibakteriell, antimykotisch und antiviral. Außerdem wirkt Süßholzextrakt antioxidativ, schleimlösend in den Bronchien und beruhigend auf die Magenschleimhaut. Im Laborversuch ließ sich sogar das Bakterium Helicobacter pylori wirksam bekämpfen.
Die antivirale Wirkung von Glycyrrhizin wurde in verschiedenen Untersuchungen gegen das HIV-1, gegen Hepatitis C-, Herpes- sowie Coronaviren nachgewiesen. Deshalb ist die Droge Süßholzwurzel in vielen Husten- und Bronchialtees enthalten. Zäher Schleim verflüssigt sich und lässt sich so weiter abhusten.
Vorsicht bei übermäßigem Verzehr
Zu lange und in zu großer Menge genossen, haben Süßholzwurzelextrakte Nebenwirkungen. Glycyrrhizin beeinflusst den Mineralkortikoid-Stoffwechsel, so dass die Hormone Aldosteron und Cortisol überproduziert werden können. Durch eine so entstehende Störung der hormonellen Signalkette im Körper kommt es zu Elektrolytverschiebungen, insbesondere zu einem Kaliummangel. Daraus können Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen, Kopfschmerzen, Ödeme und sogar Muskellähmungen entstehen. Durch den Zusatz von Salmiaksalz (Ammoniumchlorid) wird der blutdrucksteigernde Effekt noch verstärkt. Da auch der Testosteronspiegel nach Lakritzgenuss vorübergehend absinkt, kann die Libido gesenkt werden. Laut Berufsverband der Frauenärzte sollten Schwangere auf Lakritze besser verzichten, da negative Einflüsse auf den Embryo nicht auszuschließen sind.
Interaktionen sind möglich
Werden große Mengen Lakritze verzehrt und zusätzlich Thiazid- oder Schleifendiuretika eingenommen, verstärkt sich die Hypokaliämie, was wiederum die Toxizität von Herzglykosiden erhöhen kann. Durch die Blutdrucksteigerung kann sich die Wirkung von Antihypertonika verringern (funktioneller Antagonismus).
In einer taiwanesischen Studie konnte nachgewiesen werden, dass Lakritze im Körper die Aufnahme des Immunsuppressivums Ciclosporin blockiert. Dies kann fatale Folgen für Transplantationspatiet:innen haben, aber auch für Patient:innen mit Rheuma, Colitis ulcerosa, Alopecia areata oder Psoriasis.
Gefährlicher Genuss?
Im Jahre 2020 ist ein US-Bürger an einem Herzstillstand verstorben, nachdem er vor seinem Tod über Wochen täglich mindestens eine Tüte Lakritze gegessen hatte. Durch diesen übermäßigen Konsum war der Blutkaliumspiegel des Mannes enorm abgefallen. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) empfiehlt die Aufnahme von Glycyrrhizin auf unter 100 mg pro Tag zu beschränken. Für einen Erwachsenen gilt der Verzehr von maximal 100 g Lakritze als unbedenklich. Von importierten Produkten, die mehr als 200 mg Süßholzsaft pro 100 g enthalten, sollte nicht mehr als 50 g pro Tag gegessen werden.
Lakritz-Erzeugnisse, die 4 g Glycyrrhizin je kg Lakritz enthalten, müssen einen Hinweis auf der Packung tragen, dass der übermäßige Genuss bei hohem Blutdruck zu vermeiden ist. Ebenso muss Salmiaklakritze in Deutschland gekennzeichnet werden. Diese trägt bei einem Salmiakgehalt von 2 bis 4,49 % den Hinweis: „Erwachsenenlakritz. Kein Kinderlakritz“ und bei einem Gehalt von 4,5 bis 7,99 % den Hinweis: „Extra stark. Erwachsenenlakritz. Kein Kinderlakritz.“ Zusätzlich muss seit 2021 bei Salmiakgehalten über 20 g pro kg darauf hingewiesen werden, dass übermäßiger Verzehr, insbesondere bei Personen mit Nierenerkrankungen, die Gesundheit beeinträchtigen kann.
Wie so oft macht auch in Sachen Lakritze die Dosis das Gift. Wer sich ab und an verschiedene Naschereien mit Lakritze gönnt, der hat sicherlich nichts zu befürchten. Kritisch wird es erst, wenn man es übertreibt. Aber gilt das nicht eigentlich für alle Süßwaren?
AMIRA fragt: Wie steht es um euch? Mögt ihr Lakritze oder findet ihr den Geschmack eher abstoßend? Schreibt es uns in die Kommentare!