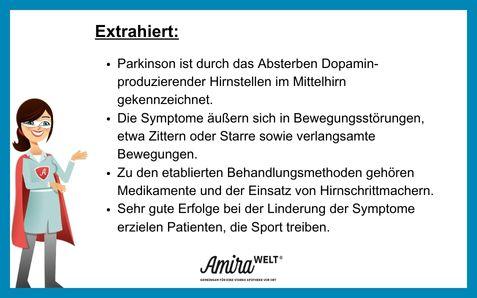Welt-Parkinson-Tag: Sport kann helfen
Auch rund 200 Jahre nach der „Entdeckung“ der Krankheit ist Parkinson noch immer nicht heilbar. Doch einzelne Symptome lassen sich behandeln. Und: Dank Sport ist ein besseres Leben möglich.
Er besiegte seine Gegner reihenweise, doch gegen diesen einen Kontrahenten hatte er keine Chance. Muhammed Ali gilt als einer der bekanntesten Patienten der letzten Jahrzehnte, die an der unheilbaren Krankheit Parkinson litten. Mittlerweile ist der einstige Box-Weltmeister tot, auch bei ihm führte die neurodegenerative Erkrankung dazu, dass die Nervenzellen im Gehirn nach und nach abstarben.
Um auf Parkinson und das damit einhergehende Leiden der Patient:innen aufmerksam zu machen, wurde 1997 der Welt-Parkinson-Tag ins Leben gerufen. Das Datum, der 11. April, ist der Tag, an dem James Parkinson auf die Welt kam. Der englische Arzt war derjenige, der als erster die Symptome der Krankheit ausgiebig beschrieb, die dann später nach ihm benannt wurde. Mittlerweile gibt es auch einen von der Parkinson Stiftung initiierten digitalen Welt-Parkinson-Tag am 29. März, um im Vorfeld auf den heutigen Aktionstag hinzuweisen und ihn öffentlichkeitswirksam anzukündigen.
In Deutschland wird die Zahl der Erkrankten mit rund 400.000 angegeben. Anders als oft angenommen ist Parkinson keine reine Alterserkrankung. Etwa zehn Prozent der Betroffenen sind jünger als 50 Jahre. Unbestritten ist, dass ein Leben mit Parkinson Herausforderungen mit sich bringt – moderne Medikamente und Therapien verschaffen jedoch vielen Erkrankten eine deutliche Linderung der Symptome und eine fast normale Lebenserwartung. „Auch für mich war die Diagnose ein Schock. Dann habe ich mich über die Erkrankung und die Fortschritte der Medizin informiert und bin mit anderen Betroffenen ins Gespräch gekommen. Das hat mir sehr geholfen, weiterhin selbstbestimmt mein Leben zu gestalten“, berichtete der ebenfalls an Parkinson erkrankte Frank Elstner jüngst auf einer Veranstaltung im Rahmen des diesjährigen digitalen Welt-Parkinson-Tages. Der beliebte 80-jährige Ex-Fernseh-Moderator engagiert sich seit Jahren als Botschafter, um auf die Erkrankung aufmerksam zu machen.
Mangel an Dopamin im Gehirn führt zu Bewegungsstörungen
Der Morbus Parkinson, wie die Erkrankung im Fachjargon heißt, ist ein fortschreitender Prozess, bei dem ein Verlust von Nervenzellen einsetzt. Sie ist hauptsächlich durch das Absterben Dopamin-produzierender Nervenzellen im Mittelhirn gekennzeichnet. Letztlich führt der Mangel an Dopamin zu einer Verminderung der Aktivierung der Großhirnrinde und damit zu Bewegungsstörungen. Zu den Leitsymptomen gehören:
- Tremor: Muskelzittern, besonders ein rhythmisches Zittern der Extremitäten
- Rigor: Muskelstarre, unelastische und erhöhte Körperspannung im Ruhezustand
- Bradykinese/Akinese: verlangsamte Bewegung, die bis zur Bewegungslosigkeit führen kann
- Posturale Instabilität: Instabilität der Haltung
Auch andere Anzeichen wie vegetative Störungen, psychische Veränderungen, Schlafstörungen mit überaktiven Träumen oder demenzielle Symptome können auftreten. Ein Symptom, das besonders gefährlich werden kann, sind Schluckstörungen, die im Laufe der Krankheit bei bis zu 80 Prozent der Patienten auftreten. Dies führt zu Problemen bei der Tabletteneinnahme und somit zu einer verringerten Wirkung der Parkinson-Medikamente. Zusätzlich kann es aufgrund einer Mangelernährung zu Gewichtsverlust, Austrocknung und im schlimmsten Fall einer Lungenentzündung kommen.
Welche Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten gibt es?
Die Auslöser einer degenerativen Krankheit sind meistens erblich bedingt oder auf eine Funktionseinschränkung durch Verschleiß zurückzuführen. Studien zeigen, dass es sich bei Morbus Parkinson nicht um eine einheitliche Erkrankung handelt, sondern um ein Leiden mit einem Spektrum verschiedener Ausprägungen.
Bisher gibt es keine therapeutische Möglichkeit, Parkinson zu heilen. Jedoch können die Symptome medikamentös behandelt und die Lebensqualität erhöht werden. Es wird oftmals eine Kombination mehrerer Medikamente verschrieben, um auf den individuellen Krankheitsverlauf zu reagieren. Zum Einsatz kommen dabei folgende Wirkstoffe:
- Levodopa (abgekürzt: L-Dopa): in Kombination mit z. B. Benserazid oder Carbidopa
- COMT-Hemmer: Entacapon, Tolcapon, Opicapon (immer in Kombi mit einem L-Dopa-Präparat)
- Dopaminagonisten: z. B. Bromocriptin, Cabergolin, Pramipexol, Ropinirol
- Anticholinergika: Amantadin, Biperiden
- MAO-B-Hemmer: Rasagilin, Safinamid
Je weiter Parkinson fortschreitet, desto weniger wirken die Arzneimittel. In diesem Fall kann möglicherweise das Implantieren eines Hirnschrittmachers helfen. Derartige neurochirurgische Behandlungsmöglichkeiten haben sich inzwischen etabliert. Eine seit Anfang der 1990er-Jahre angewandte Methode ist die sogenannte „Tiefe Hirnstimulation“ (THS). Dabei handelt es sich um einen programmierbaren Impulsgenerator (Hirnschrittmacher), der durch ein winziges Loch in der Schädeldecke in das Gehirn des Betroffenen eingesetzt wird (mehr dazu erfährst du hier). Allerdings können nur circa zehn Prozent von dieser Methodik profitieren.
Sport und Ernährung: Aktiv leben mit Parkinson in jedem Alter
Parallel zu Medikamenten und Therapieansätzen ist nachgewiesen, dass Sport hilft, mit der Krankheit umzugehen. Dilar Kisikyol, Boxweltmeisterin im Leichtgewicht, trainiert in Hamburg ehrenamtlich eine Gruppe von an Parkinson erkrankten Frauen, um gezielt deren Kraft und Beweglichkeit, Koordination und Reaktionsfähigkeit zu verbessern – und den Willen, sich gegen die Krankheit zu behaupten. „Auch die Konzentrationsfähigkeit lässt sich durch das Training steigern. Die Frauen berichten mir, wie gut es ihnen nach dem Training geht“, sagte Kisikyol auf dem digitalen Welt-Parkinson-Tag.
Ein neuer, rasant kommender Trend im Umgang mit Parkinson-Symptomen ist Tischtennis. Wolfgang Hoelscher-Obermaier, der Landesleiter von PingPongParkinson e. V., erklärte, wie Tischtennis die Parkinson-Krankheit spielerisch und effektiv ausbremst und soziale Kontakte schafft. Der Verein will bundesweit an über 100 Stützpunkten möglichst vielen Menschen mit Parkinson das Tischtennisspiel ermöglichen.
Aus zahlreichen Studien ist zudem schon länger bekannt, dass regelmäßiger Ausdauersport die Symptome verbessern kann. Neuere Studien weisen sogar darauf hin, dass körperliche Aktivität den Ausbruch und Langzeitverlauf der Erkrankung positiv beeinflussen könnte. Auch die Ernährung kann das Erkrankungsrisiko senken und dem Abbau körperlicher und geistiger Fähigkeiten bei Menschen mit Parkinson entgegenwirken.
Spenden wichtig: Öffentliche Förderung hält sich in Grenzen
Auf der Veranstaltung Ende März wurde auch immer wieder die Bedeutung von zivilem Engagement und privaten Spenden betont. James Parkinson selbst war nicht nur Arzt, sondern engagierte sich auch als Politiker, Reformer und gesundheitlicher Aufklärer. Mit dem „James Parkinson Preis für ziviles Engagement“ würdigte die Parkinson Stiftung in diesem Zusammenhang die gemeinnützige Aktion von Stefan Lauer. Aus persönlicher Betroffenheit – seine Mutter starb an Parkinson – entstand sein „Herzenswunsch“, über die Krankheit aufzuklären und die Forschungsarbeit an neuen Therapien zu unterstützen. Deshalb organisierte er in einem Winzerstädtchen an der Mosel eine Weinprobe mit Fachvorträgen zur Parkinson-Erkrankung und spendete den beträchtlichen Erlös der Stiftung.
Diese und weitere Initiativen adelte Professor Georg Ebersbach, Mitglied im Vorstand der Parkinson Stiftung und Leiter des Parkinson-Zentrums in Beelitz-Heilstätten mit den Worten: „Die Parkinson-Forschung macht derzeit beeindruckende Fortschritte. Aber sie wird durch die begrenzte öffentliche Förderung gebremst. Manche vielversprechende Forschungsansätze können nur durch private Spenden oder Forschungspreise finanziert werden. Daher bringt jeder finanzielle Beitrag die Entwicklung neuer Therapien weiter voran.“